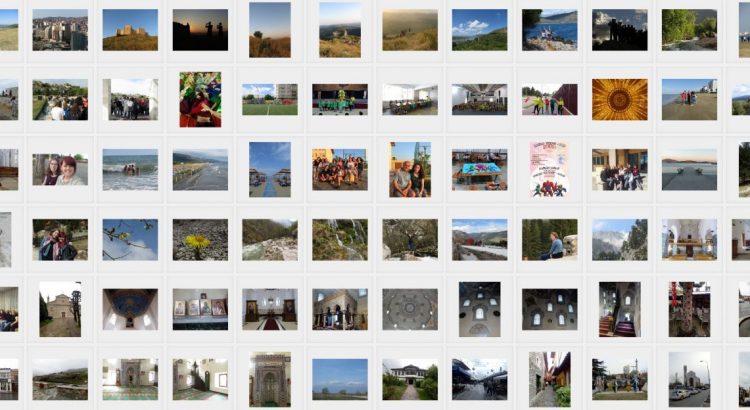Es ist November 2019. Mein Freiwilligendienst ist seit drei Monaten vorüber, die neuen Voluntäre haben ihren Dienst längst angetreten und letztes Wochenende war das Informationswochenende für zukünftige Voluntäre. (Man kann sich übrigens noch bewerben!) Ich durfte dort meine Erfahrungen teilen und werde, soweit möglich, auch in weiteren Vorbereitungsseminaren dabei sein. Abgesehen davon hat aber ein neues Kapitel für mich begonnen: Ich studiere jetzt Geographie und Soziologie. Mein Tagesablauf, meine Aufgaben, mein Umfeld – das alles hat sich verändert. Es ist also Zeit, Abschied zu nehmen von diesem Blog. An dieser Stelle darf ich euch die Blogs meiner Nachfolgerinnen empfehlen: „KOSOWO SONST? – mein Freiwilligendienst im Kosovo“ von Veronika und „Mein Abenteuer im Kosovo“ von Hannah.
Bevor ich den Blog aber beende, möchte ich den Freiwilligendienst rekapitulieren.
Meine Zeit im Kosovo …
… war so vieles, dass es schwer in Worte zu fassen ist. Aber ich habe drei Stichworte, die das Wichtigste nennen:
Lehrreich: Ich bin angekommen, kannte weder Land noch Leute. Natülich hatte ich mich informiert. Ich wusste, dass der Kosovo hauptsächlich muslimisch geprägt ist, dass Serbien und Kosovo über Unabhängigkeit und Ländergrenzen streiten und der Krieg seine Spuren hinterlassen hat. Trotzdem ist es etwas völlig anderes, die Geschichten der Leute zu hören, ihre Kultur zu erleben und mit ihnen zu arbeiten. Es ist nicht das Fakten-Lernen, wie wir es in der Schule kennen, es ist eine ganz andere Art von Lernen. Zum Beispiel habe ich gelernt, gastfreundlicher und spontaner zu sein, zu geben ohne etwas zu erwarten, Chancen zu nutzen, wo sie gerade auftreten.
Bereichernd: Die Erinnerungen, die geschlossenen Freundschaften, das Gelernte, das sind Dinge, die mir viel wert sind. Und es sind Dinge, die mir nicht weggenommen werden können, die ich nicht verlieren kann. Das ist viel mehr wert als ein Jahr früher arbeiten und studieren.
Persönlichkeitsentwicklung: Vor dem Jahr kannte ich hauptsächlich die deutsche Kultur mit ihren Normen und Werten. Ohne etwas anderes zu kennen, ist es schwierig zu reflektieren. Nach diesem Jahr aber habe ich viel über die kosovarisch-albanische Kultur gelernt und dadurch auch über die deutsche. So ist mir klarer geworden, welche Werte mir besonders wichtig sind. Ich habe selbst das Gefühl, mich in diesem einen Jahr mehr entwickelt zu haben als in den letzten drei Schuljahren. Das heißt nicht, dass ich jetzt einen ausgeschliffenen Lebensplan habe – im Gegenteil, ich habe noch so viele Möglichkeiten mehr entdeckt. Aber genau dieses Wissen über die Möglichkeiten ermöglicht mir, zum gegebenen Zeitpunkt bewusst zu entscheiden.
Das war mein Freiwilligendienst für mich.
… und die Zeit der anderen mit mir
Was hat er für die Kinder und Jugendlichen, die anderen Don-Bosco-Mitarbeiter bedeutet?
Ganz oft habe ich gehört, dass ich sie inspiriert habe. Zuerst dachte ich: Wie, aber ihr habt doch mich inspiriert, mir so viel beigebracht! Aber es funktioniert in beide Richtungen: Indem ich ihre Handlungen in Frage stelle, weil ich sie schlicht nicht kenne, fangen auch sie an, darüber nachzudenken. Wenn ich erzähle, wie ich es von mir daheim kenne und wir über Vor- und Nachteile der jeweiligen Handelsweisen diskutieren, eröffnet es ihnen – und auch mir – eine ganz andere Breite an Handlungsmöglichkeiten, die sie vorher nie in Erwägung gezogen hätten. Es braucht also keine großen Aktionen, um positiv im Gedächtnis zu bleiben. Vielmehr geht es darum, sich für die Menschen und ihre Lebenswelt zu interessieren.
Über das Jahr hinweg und auch danach durfte ich sehr viel Wertschätzung erfahren. Darunter gibt es Worte, an die erinnere ich mich besonders gerne. Deshalb zitiere ich sie hier für euch, die Übersetzungen habe ich dabei mehr sinngemäß als wörtlich gehalten:
Ich bin da
„If you need me, I’m here.“ (Falls du mich brauchst, bin ich hier für dich.) Das war ein Satz, den eine Freundin und Schülerin aus der damals elften Klasse gesagt hat. Er fiel nur so nebenbei, wie selbstverständlich, aber mir hat er so viel bedeutet, dass ich ihn groß in mein Tagebuch geschrieben habe. Es zeigt mir, dass ich ihr wichtig bin, dass ich es geschafft habe, mit ihr eine Beziehung aufzubauen und auch für sie da zu sein. Das haben ihre Abschiedsworte bestätigt: „Thanks for giving me a lot of lessons and very very good memories. I love you too very much!“ (Vielen Dank dass du mir viel beigebracht hast und für die sehr, sehr guten Erinnerungen. Ich habe dich auch sehr lieb!)
Von Herzen
Das nächste Zitat ist von einer Freundin und Schülerin, damals in der elften Klasse. Sie bezieht sich darauf, dass sie zu Beginn meines Freiwilligendienstes in einem Mirëmengjes (der Vollversammlung aller Schüler/innen) alle aufforderte, dazu beizutragen, dass ich mich in Don Bosko Gjilan zuhause fühle. Ich hatte ihr nach meinem Freiwilligendienst eine Nachricht geschrieben und mich unter anderem dafür bedankt. Das ist ein Teil ihrer Antwort: „In that time, it was just a ‚beautiful‘ sentence, because I actually didn’t know you, but now that I do, it’s more than just a sentence and it makes sense more than it did that day.“ (In diesem Moment war es nur ein „schöner“ Satz, denn eigentlich kannte ich dich gar nicht; aber jetzt, da ich dich kenne, ist es mehr als nur ein Satz und es macht mehr Sinn als es an diesem Tag tat.“)
Außerdem schrieb sie mir, dass es gut für sie war, mit mir Zeit zu verbringen, weil ich sie nocheinmal darüber nachdenken ließ, was sie mit ihrem Leben machen will. Und ziemlich am Ende ihrer Nachricht las ich diese herzlichen Worte: „You will always have a special place in our heart“ (Du wirst immer einen speziellen Platz in unserem Herzen haben) und „We won’t forget you“ (Wir werden dich nicht vergessen).
Wie Familie
Besonders wichtig ist auch Jezuelas Freundschaft für mich – und meine für sie. Vor Kurzem schrieb sie mir: „You have no idea how much I need my lil sis here“ (Du weißt gar nicht, wie sehr ich meine kleine Schwester hier brauche). Sie nennt mich Schwester – das beschreibt unser Verhältnis ziemlich gut. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben miteinander gearbeitet und dabei – und davor und danach – über Gott und die Welt geredet. Sie hat mir geholfen, wo immer nötig, und ich ihr. Jetzt bleiben wir über WhatsApp in Kontakt und wenn irgendwann möglich, wollen wir uns wieder treffen. Auch mit anderen Animatoren bin ich über WhatsApp in Kontakt.
Natürlich gab es von unserem Direktor Don Dominik eine Abschiedrede für mich. Ein Satz ist mir dabei besonders hängen geblieben: „You’re like a daughter to us.“ (Du bist wie eine Tochter für uns.)
Und Don Bosko ist wie eine zweite Familie, ein zweites Zuhause für mich.
Damit möchte ich Don Dominik, Don Oreste, Jezuela und allen anderen Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und Animator*innen danken für die wundervolle Zeit, für die mir trotz aller Wortgewandtheit ein bisschen die Worte fehlen. Ich werde diese Zeit nie vergessen!
Eure Bettina
So I want to thank Don Dominik, Don Oreste, Jezuela and all co-workers, students and animators for the wonderful time, that I can’t really put into words. I’ll never forget this time!
Yours, Bettina
Edhe tash me pak gjuhë shqipe: Falemindert shumë Don Dominik, Don Oreste, Jezuela edhe krejt tjerat per çdo kohë e mrekullueshme. S’mundem harroj çdo kohë! (Më falni për krejt gabim – e di, s’mundem më fal mirë…)
Bettina
PS: Ja, bei der Veröffentlichung ist es bereits Dezember – das Studium nimmt mich in Beschlag und gut Ding will schließlich Weile haben 😉 Vielen Dank, liebe Leser*innen, dass ihr so lange durchgehalten habt; vielen Dank, dass ihr mich über das Jahr hinweg begleitet habt! Falls ihr wissen wollt, warum ich ausgerechnet dieses Titelbild für den Abschiedsbeitrag gewählt habe, klickt euch in den vorigen Blog.